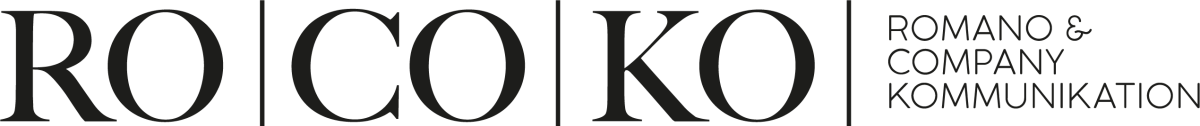Aktueller Blog-Artikel
#overtourismus #downtownswitzerland #weltstadtZürich
Zürich, 30. August 2025
Autor Francesco L. Romano
Leidet Zürich an Overtourismus?

Zürich platzt aus allen Nähten. Und gefühlt wird es immer enger, besonders in der Altstadt. Ganz egal ob mit 35 Grad am Bürkliplatz oder mit dem ersten Schnee am Limmatquai: Tagein, tagaus strömen abwechselnd US-amerikanische Senioren in Regenjacken, quirlige Inder oder dauerknipsende Chinesen durch die mittelalterlichen Gassen Zürichs. Die Bewohner leiden und mittlerweile vermag auch das Stadtbild das Malheur nicht mehr zu verbergen. Der Gang durchs Niederdorf wird zum Nerven-Slalom, im Café spricht die Bedienung nur noch Englisch, Touristen entsorgen ihren Take-away Abfall nonchalant in die für Züri-Abfallsäcke vorgesehenen Entsorgungsschächte. Leidet Zürich an Overtourismus? Und wie kam es, dass die traditionell steife und etwas verbissene Zwingli-Stadt plötzlich zum Touristen-Mekka mutierte?
Overtourism vs. Overmobility
Ein kurzer historischer Exkurs kann an dieser Stelle dienlich sein. Der Tourismus war nämlich lange nur dem Adel vorbehalten. Feinbetuchte Jugendliche aus gutem Hause reisten seit der Renaissance – noch vor ihren offiziellen Eintritt in die Gesellschaft mittels Heirat – durch Mitteleuropa in Richtung Süden. Ihr Ziel waren die wichtigsten Schauplätze der Antike, so zum Beispiel Frankreich, Italien oder das Heilige Land. Diese langwierigen und strapaziösen Reisen dienten der Bildung und Weiterbildung von Geist und Charakter. Besonders populär war die «Grand Tour» im 18. und 19. Jahrhundert. Was ist vom Bildungstourismus im 20. Jahrhundert und heutzutage geblieben? Nicht viel, bedauerlicherweise. Die explodierende Mobilität, von der Industrialisierung angefeuert und seit Mitte des letzten Jahrhunderts zur Selbstverständlichkeit avanciert, ist heute ein Massenprodukt. Die Billigairlines dominieren und drücken die Preise von traditionellen Luftfahrtgesellschaften. Eigentlich ist Overtourismus nur ein Symptom, und zwar von einer masslosen Mobilität. Interessanterweise existiert der Begriff «Overmobility» nicht. Möglicherweise weigern wir uns als Gesellschaft, uns die Konsequenzen einer grenzlosen Mobilität einzugestehen.
Von «Bildungs»-Reise zur «Abbildungs»-Reise
Doch nicht nur die Technik und Infrastruktur haben sich grundlegend verändert – auch unser kulturelles Verständnis von Tourismus hat sich gewandelt. Und auch hier spielt die Technik eine zentrale Rolle. Durch die Digitalisierung wird das Reisen immer mehr zu einem Sammeln von Daten. Täglich werden hunderttausende Bilder geknipst und Videos aufgenommen. Das Reisen reduziert sich auf dessen Dokumentation: Wir bilden uns nicht mehr weiter, wir bilden weiter ab. Ein relativ aktuelles Beispiel ist der touristische Hype in die Schweiz vorwiegend aus Asien, ausgelöst durch eine koreanische Telenovela. Netflix produzierte die Serie «Crash Landing on you» 2019 und verhalf dieser komödiantischen Liebesschnulze über eine südkoreanische Unternehmerin und einem Angehörigen der nordkoreanischen Armee zu internationalem Erfolg. Heute sind jene Schweizer Hotspots, die in der Serie vorkommen, überhitzte Tourismusknotenpunkte. Auch Zürich ist immer wieder prominent zu sehen und – sogar in jedem einzelnen Vorspann der 16 Folgen – der Lindenhof. Kein Wunder pilgern Touristen aus dem asiatischen Raum bereits ab 5 Uhr 30 und bis spät in den Tag hinein an den Aussichtspunkt. Keiner interessiert sich zwar für die römische Mauer, das älteste Steinbauwerk Zürichs, die Archäologie-Ausstellung im Hofkeller oder den anliegenden, prachtvollen Sitz der Zürcher Freimaurerloge «Modestia cum libertate». Dafür wird wie wild geknipst: pausenlos entstehen Selfies und Videos, wie man sich zu zweit über den Hof mit dem Grossmünster im Hintergrund entgegenschreitet – also eine genaue Abbildung der Serie-Szene.
Digitale Höhlenmalerei
Erst kürzlich, am 31. Juli 2025, publizierte die Gratiszeitung «20 Minuten» einen Artikel zum Overtourismus in der Schweiz. Mit dem Titel «Fluch oder Segen?» illustriert die Zeitung den Massenandrang, um einen Blick auf die Trümmelbach-Wasserfälle in Lauterbrunnen zu werfen. In Schweizer Zurückhaltung üben sich die interviewten Anwohner. Trotz Abfall und Stau scheint niemand ein Problem mit den Touristen zu haben, die immer öfters nur wegen eines Fotos ins Dorf fahren und dann gleich wieder verschwinden. Auch hier das gleiche Prinzip wie in Zürich: Die Sozialen Medien wie Tiktok fluten uns mit Bildern und führen Tausende an den gleichen Ort, wo man das gleiche Foto schiesst, um es in den gleichen sozialen Plattformen wieder und wieder zu veröffentlichen. Ein Daumenkino des immer gleichen Moments. Aber wozu? Wieso stehen Touristen Stunden im Regen an nur für ein Foto? Hier haben Spekulationen freien Lauf. Eine davon lautet, dass es um Urheberschaft geht. Mein Foto ist zwar identisch wie tausende andere, aber es ist meins. Es dokumentiert meine Anwesenheit vor Ort, hält meine Erfahrung fest und das Posten macht es öffentlich und nachweisbar. Das Fotografieren ist eine Bestätigung der eigenen Existenz. Statt Höhlen zu bemalen, knipsen wir heute ein Foto des Grossmünsters.
Assimilation durch Imitation
Ein weiterer Erklärungsversuch für den Abbildungswahn vieler Touristen ist viel profaner. In einer Welt, in der echte Gemeinschaften gegenüber virtuellen das Nachsehen haben, ist der eigene gesellschaftliche Status in den digitalen Communities von vitaler Wichtigkeit. Wir sind soziale Wesen. Durch das Imitieren können wir uns assimilieren, werden Teil vom Ganzen. Am liebsten wären wir nicht nur Teil, sondern ein ganz besonders wichtiger Teil vom Ganzen. Diesen Mechanismus nutzen die Sozialen Medien aktiv. Für jeden erfolgreichen Post gibt es Leckerchen in Form von Likes. Und wie jedes gewöhnliche System sind auch die Sozialen Medien selbsterhaltend (sage nicht ich, sondern die Systemtheorie). Der Tourist ist in diesem Kontext der ideale User: Geltungsdrang, überdurchschnittlich häufige Postings und viele Bilddateien, die ein Zuhause suchen. Lässt sich dieser Teufelskreis brechen? In Anlehnung an ein bekanntes Zitat könnte man sich überlegen: «Stell Dir vor, es sind die Sozialen Medien und keiner postet was».
Downtown Switzerland
Nun, zurück zu Zürich. Hat die Limmatstadt nun ein Problem mit Overtourismus? Wer in der Altstadt wohnt, kann über diese Frage nur müde lächeln. Ja, definitiv, ohne Frage innerhalb des Altstadtkerns. Natürlich tragen Billigairlines, Netflix und Tiktok eine Mitschuld. Doch Zürich hat es sich auch selbst eingebrockt. In den frühen 00er Jahren erlitt die Limmatstadt eine Erschütterung ihres Selbstbildes. Ihre Reputation als internationale Bankenmetropole hatte Schaden angenommen. Zunächst das Grounding der Swissair, später der drohende Zusammenbruch der UBS. Wichtige Pfeiler ihres Selbstverständnisses brachen ein oder wankten gehörig. Nach dem Motto «Angriff ist die beste Verteidigung» wurden bis tief in die 10er Jahre schwindelerregende Tourismus-Budgets aufgefahren. «Downtown Switzerland», «Little Big City» oder «World Class. Swiss Made»: Die Slogans von Zürich Tourismus lesen sich heute als Projektionen des eigenen Selbstbilds. Kanton, Stadt und Zürich Tourismus forcierten als Dreiergespann die Profilierung von Zürich zur Weltstadt. 2011 verkündet Elmar Ledergerber, ehemaliger Stadtpräsident und damals Präsident von Zürich Tourismus: « (die Zusammenarbeit) bringt Zürich in eine neue Liga als globale Top Tourismus Destination». Im gleichen Artikel im Tages-Anzeiger vom 14. Juli 2011 hält Stadtpräsidentin Corinne Mauch fest, Ziel sei es, mit einem gemeinsamen Auftritt die touristische Nachfrage zu erhöhen, zusätzliche Firmen und Arbeitsplätze anzusiedeln und damit die Wirtschaft in der Region zu stärken. Ist Zürich heute eine Top-Tourismus Destination? Und falls ja, welchen Preis zahlt die Stadt Zürich dafür?
Die Geister, die Zürich rief
Zufälligerweise beobachtete ich heute Morgen, wie Corinne Mauch mit ihrem eBike auf dem Weg ins Rathaus in eine Ansammlung Touristen geriet. Mit Nachdruck klingelnd und mit zähneknirschendem Gesichtsausdruck suchte sie balancierend auf dem Velo einen Ausweg. Wie heisst es doch so schön, frei nach Goethe: «Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los». Seit 2011 steigen die Logiernächte in der Region Zürich von knapp 5 Millionen auf 7.3 Millionen im 2024. Doch es ist nicht nur die angeblich erfolgreiche touristische Entwicklung, die zum Dichtestress führt. Die Bevölkerungsentwicklung trägt ebenfalls dazu bei. Diese und ihre Konsequenzen sind besonders in der Altstadt gut nachzuweisen. Jedenfalls haben eine Reihe von Fehleinschätzungen für ein lange verzerrtes Bild gesorgt. Im Zuge des Freizügigkeitsabkommens und der darauffolgenden Abstimmung zur Personenfreizügigkeit im Jahr 2009 explodiert die Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz und besonders im Brennpunkt Zürich. 2005 veröffentlicht die Stadt Zürich erstmals eine Prognose zur Bevölkerungsentwicklung. Hier heisst es: «Für 2025 werden knapp 376 000 Personen prognostiziert, was einem Zuwachs um knapp 11 000 oder 3 Prozent entspricht.» Bereits 2024 verzeichnet die Stadt Zürich knapp 450 000 Personen. Die Zahlen für 2025 stehen noch nicht zur Verfügung, doch die jüngste Prognose geht von 457 300 Personen aus. Heute leben in der Stadt Zürich also im Vergleich zur damaligen Fehlschätzung rund 7.5-mal so viele Personen.
«Visitor Economy» als strategisches Konzept
Angesichts dieser für Einheimische belastenden Entwicklungen bemühte Zürich Tourismus Zahlen der geschätzten Wertschöpfung, um sein stattliches Marketingbudget von über 10 Millionen CHF (Stand 2021) zu rechtfertigen. Mittlerweile muss man solche Zahlen auf den offiziellen Plattformen suchen. Auch hier ist wohl die Erkenntnis durchgesickert, dass die aktuelle Situation für die Bewohner äusserst belastend ist. Die Strategie von Zürich Tourismus? In ihrer in Auftrag gegebenen Studie «Tourismus neu denken» lautet die Lösung «Visitor Economy». Diese hat zum Ziel «Verständnis und Akzeptanz für den Tourismus zu stärken». Weiter betont die Studie die Wichtigkeit von nachhaltigen städtischen Grossanlässen und finanziert mit sechsstelligen Beiträgen Hotels in der Stadt, die nachhaltig operieren. Was auffällt: Zürich Tourismus betrachtet auch weiterhin Tourismus rein wirtschaftlich, während es in seinen Erläuterungen fast schon obsessiv das Stichwort «Nachhaltigkeit» bemüht. Damit kann man vielleicht einem politischen Auftrag gerecht werden, doch der einseitige Blick auf den Tourismus und die widersprüchliche Auslegung von Nachhaltigkeit sind offensichtlich.
Identitätsausverkauf
Was ist nachhaltiger Tourismus eigentlich? Wohl kein Tourismus, der dem lokalen Gewerbe Umsatzrückgänge beschert und Traditionsgeschäfte eingehen lässt. Doch genau das ist heute in Zürich zu beobachten. In den letzten zwei Dekaden hat sich zum Beispiel die Bahnhofstrasse immer stärker zu einer beliebigen europäischen Einkaufsmeile für Gutbetuchte gewandelt. Wo einst Lebensmittel- und Delikatessenläden, Floristen, Haushaltsgeschäfte oder Restaurants als Treffpunkt dienten, prangen heute die Logos multinationaler Konglomerate. Die Konsequenz: Anonymisierung. Selbstverständlich darf auch die Identität einer Stadt nicht statisch verharren. Doch Zürich bemüht sich seit Jahrzehnten um das Gegenteil. Die Limmatstadt entfremdet sich selbst, dem ersehnten Ruf einer wirtschaftsstarken Weltstadt opfert sie die eigene Sprache, das lokale Gewerbe und gehörig Lebensqualität. Ist dieser Identitätsausverkauf noch aufzuhalten? Der Blick auf aktuelle Tourismusstudien stimmt pessimistisch. Gemäss «Tourismusakzeptanz», einer Studie aus dem Jahre 2024, fühlen sich landesweit 23% der Schweizer Bevölkerung an ihrem Wohnort nicht mehr zuhause, während 25% sich in ihrem Alltag durch Touristen gestört fühlen. Wie hoch dieser Prozentsatz in «Downtown Switzerland» wohl sein mag?

BloCoCo: Blog Corporate Communications
Der Blog zur Kommunikation
Statt Bla Bla Bla gibt es hier Blococo, oder mit anderen Worten: Blog Corporate Communications. Lesen Sie Kommentare und Analysen zur Kommunikation in der Neuzeit. Gute Lektüre.

WEitere Blog-Artikel
#digitalisierung #Goldvreneli #Sammelfrust
Zürich, 5. Juli 2025
Autor Francesco L. Romano
Das Jubiläums-Goldvreneli: eine Dreigroschenoper im Online-Shop
Ich gebe es ja zu: Es war ein nostalgischer Reflex. Mein Vater hat lange Jahre Silbermünzen gesammelt. Als Kind mochte ich den Münzordner mit den vielen glänzenden Plastikseiten besonders gerne, gefüllt mit abgegriffenen, aber genau deswegen wertvollen, alten Münzen. Zudem sind mir, einem Kind der 70er, auch die Grossmamis mit klirrenden Bettelarmbändern und den daran pendelnden, eingefassten Goldvrenelis eine liebe Erinnerung. Wie bereits eingestanden: Es war ein sentimentaler Reflex, als bei der Ankündigung der 100 Jahre Jubiläumsmünze des „Goldvreneli“ durch die Gesellschaft Swissmint (offizielle Münzen-Ausgabestelle des Bundes) ich mir vornahm, eine der auf 2'500 Stück limitierten Goldmünzen zu erwerben. Ach, wie stolz hätte ich meinen Papa gemacht. Doch so weit kam es nicht.
Vorbereitung ist das A und O
Natürlich war mir die angespannte Ankaufslage bekannt: Numismatiker und Sammler aus der ganzen Schweiz warteten wohl mit schwitzigen Händen vor dem Computer, um eine der begehrten Münzen zu erwerben. Der Kauf war nur online im Shop der Swissmint möglich. Der Käufer benötigte ein CH-Login, das im Vorfeld zu beantragen ist. Hierbei handelt es sich um eine Login-Lösung des Bundesamt für Informatik und Telekommunikation, BIT. Das CH-Login nutzen User für verschiedene Behördendienstleistungen in der ganzen Schweiz. Also Ärmeln hoch und fleissig alles vorbereiten: das Login bestellen und testen, das Passwort sichern und voller Vorfreude dem Verkaufsdatum, Dienstag, 1. Juli 2025, entgegenfiebern.
Auf die Plätze, fertig... aus
Der Handy-Reminder zeigte am 1. Juli pünktlich um 8 Uhr 40 an: Gleich geht es los. Ich sass also vor dem Computer, loggte mich ein und refreshte die Webseite in regelmässigen Abständen. Man weiss ja nie, vielleicht geht der Verkauf ja trotzdem einige Minuten vor dem offiziellen Start los. Nun ja, los ging nix. Gar nix. Um 8 Uhr 58 war die Webseite von Swissmint bereits zusammengebrochen. Server nicht verfügbar, Login-Anmeldung führte ins digitale Nirvana. Nicht mit mir, so mein kämpferischer Gedanke. Ich folgte der nach einiger Zeit erscheinenden Einblende, man solle es in wenigen Minuten nochmals versuchen. Irgendwann konnte man das Login wieder benutzen, aber es erschien kein Warenkorb. Dann ein schwaches Licht am Ende des digitalen Tunnels: Ich konnte eine Bestellung tätigen. Doch plötzlich wollte das Login nicht mehr. Ich wurde aufgefordert, zweimal das Login einzugeben, um immer wieder auf einer trostlosen Fehlerseite zu landen. „Sorry, etwas ist schiefgelaufen.“
Lebenszeit, adieu!
Nach 65 Refresh-Versuchen, 14 (!) Bestätigungs-SMS von CH-Login und vergeudeten drei Stunden meines Lebens: der letzte Versuch. Den Kundendienst von Swissmint kontaktieren. Wenn es Swissmint digital nicht auf die Reihe kriegt, dann möglicherweise analog. Doch auch hier: Die einzige Reaktion war eine automatisierte (!) Email mit einer ernüchternden Information: „Trotz Vorbereitung ist die IT-Infrastruktur zusammengebrochen. (...) Wir analysieren die Probleme sorgfältig, um unsere Verkaufsprozesse zu verbessern.“
Customer Journey: ein neues All-In-Ferienangebot?
Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber offensichtlich hat man bei Swissmint von „Customer Journey“ noch nie etwas gehört. Entsprechend fällt es einem schwer nachzuvollziehen, worin diese „Vorbereitung“ eigentlich bestand. Der in allen Mitteilungen zitierte Ansturm kam ja nicht überraschend. Im Vorfeld gab es grosszügig PR zum Verkaufsstart der Jubiläumsmünze. Und technische Lösungen, um genau solche Überlastungen der Server zu vermeiden, gibt es seit Jahrzehnten. Diese stellen die Server-Kapazitäten und Webabwicklungen selbst bei ausserordentlich hohen Hits (Zugriffen auf die Webseite) sicher. Wie sonst lasse sich der Ticketverkauf einer Konzertarena mit einer Kapazität von bis zu 60'000 Tickets und unmittelbaren Ausverkaufspotenzial bewältigen? Selbstverständlich könnte man nun kontern, dass es bei Swissmint „nur“ um 2'500 Münzen ging. Doch werfen wir einen Blick auf den generierten Umsatz: Auf den Einzelpreis von 3'500 Franken pro Münze ergibt dies satte 8.75 Millionen! Nun ja, wenn sich Konzertveranstalter – die selbst bei schwindelerregenden Kapazitäten an einem Abend weniger einnehmen – eine solche IT-Lösung leisten können, dann sollte man davon ausgehen können, dass Swissmint in einer solch öffentlichkeitswirksamen Aktion nicht ins IT-Fettnäpfchen tritt. Doch vielmehr als ein Treten, war's ein freier Fall.
Trotz Bestätigung leer ausgegangen
Und last, but not least: Selbst einige scheinbar erfolgreiche Käufer, die von Swissmint eine Bestellungsbestätigung erhalten hatten und den stolzen Preis beglichen, gingen leer aus. Watson berichtet hierzu am 4. Juli. Die Leserkommentare nicht verpassen! Immerhin hier gibt es in dieser ernüchternden Geschichte etwas zu lachen.